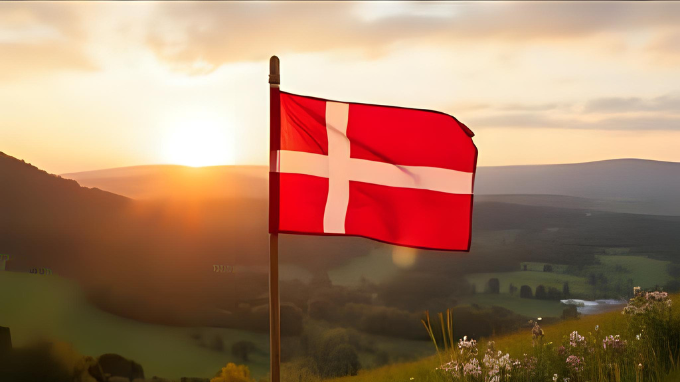Dänemark hat vorgemacht, wie man Migration steuern kann, ohne die humanitäre Pflicht grundsätzlich aufzugeben. Während Deutschland im Jahr 2023 rund 352.000 Asylanträge registrierte, sank die Zahl in Dänemark auf gerade einmal rund 2.500 im Jahr 2024 – ein Rückgang von fast 90 % gegenüber 2015. Diese Entwicklung ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer klaren und vernunftbewegten Strategie.
Weniger Daueraufenthalte, mehr Planbarkeit
In Dänemark sind Aufenthaltstitel grundsätzlich temporär. Sie werden regelmäßig überprüft und nur verlängert, wenn die Schutzgründe weiterhin bestehen. Dieses Prinzip sorgt dafür, dass aus humanitärer Hilfe kein dauerhafter Zuzug ohne Integration wird.
Deutschland hingegen vergibt überwiegend längerfristige oder dauerhafte Titel, was Rückführungen erschwert und die Integrationssysteme überlastet.
Konsequente Rückführungen statt endloser Verfahren
Dänemarks Rückkehrstellen erreichen bei abgelehnten Fällen freiwillige Rückkehrraten von bis zu 95 %. Möglich wird das durch ein Zusammenspiel aus klaren Fristen, finanziellen Anreizen und notfalls strengen Abschiebungen. In Deutschland dauern Verfahren hingegen oft über acht Monate im BAMF – in Gerichten zusätzlich über 16 Monate. Das führt zu Unsicherheit, hohen Kosten und sinkender Akzeptanz in der deutschen Bevölkerung.
Klare Grenzen bei Sozialleistungen
Kritiker nennen es hart, Befürworter nennen es ehrlich: Dänemark kürzte Sozialleistungen für Asylbewerber deutlich und führte sogar die Möglichkeit ein, Wertgegenstände bei der Ankunft einzuziehen („Schmuckgesetz“). Ziel ist nicht, Menschen zu drangsalieren, sondern die Attraktivität für Wirtschaftsmigration zu senken. Das Gesetz wurde bisher nur selten angewendet, erfüllte aber vor allem eine Signalwirkung, um Dänemark als weniger attraktives Zielland für Wirtschaftsmigration darzustellen.
Auch in Deutschland mehren sich Stimmen, die eine strengere Bindung der Leistungen an Kooperationsbereitschaft fordern – ganz im Sinne einer liberal-konservativen Verantwortungspolitik. Das Modell der Bezahlkarte für Flüchtlinge ist ein erster Schritt. Leider wird selbst dieses marginale Instrument bereits von einigen NGOs und linken Initiativen ausgehebelt.
Schutz der sozialen Kohäsion
Besonders umstritten, aber wirksam: Dänemarks „Anti‑Ghetto‑Gesetz“. Es verhindert die Entstehung von Parallelgesellschaften, indem es Wohnungszuweisungen steuert und bestimmte Stadtteile bewusst durchmischt. Deutschland kennt ähnliche Probleme in Ballungsräumen, wo Integration scheitert und Frust wächst. Hier könnte ein Blick nach Kopenhagen wertvolle Impulse liefern.
Was Deutschland lernen kann
Ein deutsches „Modell Dänemark“ müsste EU‑rechtskonform und grundgesetzfest sein. Folgende Schritte wären aber möglich:
- Temporäre Aufenthaltstitel mit jährlicher Überprüfung
- Verstärkte Rückkehrprogramme und striktere Abschiebungen
- Bezahlkarte statt Bargeld bei Leistungen
- Strenge Regeln beim Familiennachzug
- Gezielte Wohnsitzauflagen, um Ghettobildung zu verhindern
Fazit: Strenge sichert Liberalität
Eine Mehrheit der Deutschen – 77 % laut ARD‑Deutschlandtrend (Infratest dimap) – fordert eine Wende in der Asylpolitik. Dänemark beweist, dass ein harter, aber klarer Kurs nicht nur möglich, sondern erfolgreich ist. Für Deutschland bedeutet das: Wer die Offenheit und Stabilität unseres Landes bewahren will, darf nicht wegsehen. Strenge Regeln sind kein Verrat an der Humanität – sie sind die Voraussetzung, damit Liberalität und Solidarität mit Menschen, die wirklichen Rechtsanspruch auf unseren Schutz haben, auch in Zukunft Bestand haben.